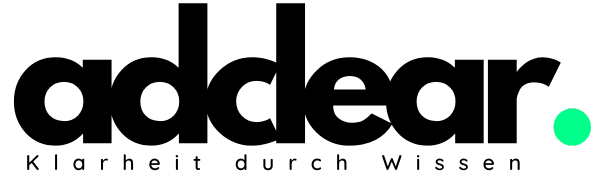Wenn ein Hund beschädigt fremdes Eigentum, stellt sich sofort die Frage nach der Haftung. In gut jedem fünften deutschen Haushalt lebt ein Hund, und damit steigt auch das Risiko von Schäden, die durch diese Tiere verursacht werden können. Grundsätzlich haften die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer für Gefahren, die von ihrem Tier ausgehen – und zwar in unbegrenzter Höhe.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Halter beim Vorfall anwesend war oder nicht. Die sogenannte Gefährdungshaftung beim Hund bedeutet, dass Besitzer auch dann verantwortlich sind, wenn ihr Vierbeiner während eines Spaziergangs mit einem Nachbarn oder Hundesitter einen Schaden verursacht. Wer regelmäßig fremde Hunde betreut oder Hunde gassi führt, sollte daher unbedingt die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. In Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist eine Hundehaftpflicht-Versicherung für alle Rassen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dieser Artikel erklärt, wer haftet, wenn ein fremder Hund in der eigenen Obhut Schaden anrichtet, und welche Rolle Versicherungen dabei spielen.
Gefährdungshaftung: Warum Halter immer haften
Die rechtliche Verantwortung für Hundehalter geht weit über die normale Sorgfaltspflicht hinaus. Der Gesetzgeber hat hierfür ein spezielles Haftungskonzept entwickelt – die sogenannte Gefährdungshaftung. Diese strikte Regelung macht Hundebesitzer für sämtliche durch ihre Tiere verursachten Schäden haftbar, selbst wenn sie persönlich keine Schuld trifft.
Was bedeutet Gefährdungshaftung?
Die Gefährdungshaftung ist ein zentrales Element des deutschen Zivilrechts und in § 833 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verankert. Der Gesetztext besagt: „Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“ Diese Regelung geht von einem einfachen Grundsatz aus: Wer ein Tier hält, trägt die Verantwortung für alle Risiken, die von diesem Tier ausgehen können.
Der Gesetzgeber begründet diese strenge Haftung mit der grundsätzlichen Unberechenbarkeit von Tieren. Selbst gut erzogene und normalerweise folgsame Hunde können in bestimmten Situationen unvorhersehbar reagieren. Sie können erschrecken, spontan loslaufen oder im Spiel jemanden versehentlich verletzen. Genau diese unberechenbare Natur von Tieren bildet die Grundlage der Gefährdungshaftung.
Für den Geschädigten bedeutet die Gefährdungshaftung einen wichtigen Schutz: Er muss nicht nachweisen, dass der Hundehalter etwas falsch gemacht hat – es genügt der Nachweis, dass der Schaden durch den entsprechenden Hund verursacht wurde.
Unabhängigkeit vom Verschulden
Die Besonderheit der Gefährdungshaftung liegt in ihrer Verschuldensunabhängigkeit. Anders als bei vielen anderen Haftungsformen spielt es keine Rolle, ob der Hundehalter sorgfältig gehandelt hat oder ihm ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Der Halter haftet, selbst wenn er alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat.
Diese Verschuldensunabhängigkeit wird auch als „reine Gefährdungshaftung“ bezeichnet. Der Halter kann sich grundsätzlich nicht mit dem Argument entlasten, dass er selbst alles richtig gemacht hat. Die bloße Tatsache, dass er ein potenziell gefährliches Tier hält, begründet seine Haftung.
Allerdings kann in bestimmten Fällen ein Mitverschulden des Geschädigten berücksichtigt werden. Wenn beispielsweise jemand einen Hund provoziert oder trotz Warnung streichelt, kann dies zu einer anteiligen Haftung führen. Dies wird als Haftungsquote bezeichnet und kann beispielsweise zu einer Aufteilung von 70 zu 30 Prozent führen.
Die Haftung des Hundehalters erstreckt sich auf verschiedene Schadensbereiche:
- Personenschäden (Verletzungen anderer Menschen)
- Sachschäden (beschädigte Gegenstände)
- Vermögensschäden (z.B. entgangener Gewinn)
Beispiele: Hund beschädigt fremdes Auto
In der Praxis gibt es zahlreiche Situationen, in denen Hunde Schäden an fremdem Eigentum verursachen können. Besonders häufig sind Schäden an Fahrzeugen:
Ein typisches Beispiel: Ein Hundehalter parkt seinen Wagen am Straßenrand und lässt seinen Hund aussteigen. Das Tier springt sofort auf die Straße und verursacht einen Unfall, bei dem ein vorbeifahrendes Auto beschädigt wird. Selbst wenn der Halter keine Zeit hatte zu reagieren, haftet er vollumfänglich für den entstandenen Schaden.
In einem vom Landgericht Coburg entschiedenen Fall (Az. 22 O 283/07) wurde festgestellt, dass ein Autofahrer nicht damit rechnen muss, dass ein angeleinter Hund unvermittelt auf die Fahrbahn springt. In solchen Fällen haftet grundsätzlich der Hundehalter für sämtliche Schäden am Fahrzeug.
Bei einem anderen Fall vor dem Landgericht München I reißt sich ein Hund los, ein Autofahrer versucht auszuweichen und verursacht einen Auffahrunfall. Interessanterweise sah das Gericht hier eine Teilschuld beim Autofahrer, da dieser bei entsprechender Aufmerksamkeit den Hund hätte sehen müssen. Die Teilschuld des Autofahrers wurde mit 30 Prozent angesetzt. Dennoch sollten sich Hundehalter nicht darauf verlassen, dass andere Gerichte ähnlich entscheiden.
Für Hundehalter bedeutet die Gefährdungshaftung ein erhebliches finanzielles Risiko. Der Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung ist daher unerlässlich. Diese Versicherung übernimmt berechtigte Schadenersatzansprüche und wehrt unberechtigte Forderungen ab. In einigen Bundesländern ist eine solche Versicherung bereits gesetzlich vorgeschrieben.
Im Gegensatz zur Tierhalterhaftung wird bei der Autoversicherung (Kfz-Haftpflicht) übrigens anders verfahren: Läuft ein Hund vor ein Auto und verursacht einen Unfall am Fahrzeug, übernimmt die Teilkaskoversicherung des Autofahrers die Reparaturkosten.
Grundsätzlich gilt bei der Gefährdungshaftung: Der Hund ist schuld, der Halter muss zahlen – unabhängig von persönlichem Verschulden und in unbegrenzter Höhe.
Tieraufseher und ihre Verantwortung
Im Unterschied zur strengen Gefährdungshaftung des Tierhalters gelten für Tieraufseher andere rechtliche Grundlagen. Während der Hundehalter grundsätzlich immer haftet, greift bei Personen, die nur zeitweise auf einen fremden Hund aufpassen, ein anderes Haftungsprinzip.
Wer gilt als Tieraufseher?
Als Tieraufseher bezeichnet das Gesetz Personen, die durch Vertrag die Führung der Aufsicht über das Tier für den Halter übernehmen. Dies ist in § 834 BGB geregelt. Entscheidend ist dabei, dass dem Tieraufseher die selbständige allgemeine Gewalt und Aufsicht über den Hund übertragen worden ist. Tieraufseher übernehmen für den Halter in dessen Interesse und auf dessen Rechnung die Sorge für das Tier und haben eine gewisse Selbständigkeit und Entscheidungsbefugnis.
Typische Beispiele für Tieraufseher sind:
- Inhaber einer Hundepension
- Personen, die den Hund während des Urlaubs der Besitzer in Obhut nehmen
- Professionelle Hundesitter oder Gassigeher
Die Übernahme der Aufsicht kann dabei auch durch einen mündlichen Vertrag erfolgen oder durch schlüssiges Verhalten, wie etwa die Übergabe des Hundes für den mehrwöchigen Urlaub. Rechtlich gesehen handelt es sich dann um einen unentgeltlichen oder entgeltlichen Verwahrungsvertrag gemäß § 688 oder § 690 BGB.
Allerdings nicht jede Person, die kurzzeitig mit einem fremden Hund spazieren geht, gilt automatisch als Tieraufseher. Bei einer reinen Gefälligkeit – wenn jemand beispielsweise den Hund des Nachbarn einmalig während des Einkaufs beaufsichtigt – handelt es sich üblicherweise nicht um eine vertraglich übernommene Aufsicht, sondern um ein Gefälligkeitsverhältnis ohne Rechtsbindungswillen.
Je regelmäßiger und eigenständiger ein fremdes Tier beaufsichtigt wird, desto eher kann von einer vertraglich übernommenen Aufsicht ausgegangen werden.
Haftung nur bei Verschulden
Im Gegensatz zur verschuldensunabhängigen Haftung des Tierhalters haftet der Tieraufseher nur bei Verschulden. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass der Aufseher nur dann verantwortlich ist, wenn er das Tier nicht mit der erforderlichen Sorgfalt beaufsichtigt hat.
Die Haftung des Tieraufsehers basiert auf einem vermuteten Verschulden. Diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden. Nach § 834 Satz 2 BGB ist der Tieraufseher nicht verantwortlich, wenn er nachweisen kann, dass er:
- bei der Beaufsichtigung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat, oder
- der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden wäre
Dies bedeutet, dass ein Hundesitter, der alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, nicht für Schäden haftet, die der Hund dennoch verursacht. Reißt sich beispielsweise ein Hund trotz ordnungsgemäßer Sicherung unerwartet los, könnte der Tieraufseher unter Umständen von der Haftung befreit werden.
Die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht steigen dabei, je unvorhersehbarer und unberechenbarer das Verhalten des Tieres ist. Bei Hunden mit bekanntem problematischen Verhalten muss der Aufseher besondere Vorsicht walten lassen.
Typische Fehler: Hund ohne Leine
Ein häufiger Fehler, der zur Haftung des Tieraufsehers führen kann, ist das Spazierengehen ohne Leine in Situationen, in denen eine Leinenpflicht besteht oder besondere Vorsicht geboten ist. Wer mit einem Hund, der nicht zuverlässig folgt oder gerne ausreißt, ohne Leine Gassi geht, muss besonders aufpassen.
Läuft ein unangeleinter Hund auf die Straße und verursacht einen Verkehrsunfall, haftet der Tieraufseher in der Regel für den entstandenen Schaden. Auch wenn der Hund Passanten anspringt oder andere Tiere verletzt, während er ohne Leine geführt wird, kann dies als Verletzung der Sorgfaltspflicht gewertet werden.
Darüber hinaus sollte beachtet werden:
- In Naturschutzgebieten ist das Führen von Hunden ohne Leine oft verboten
- Nicht alle Hunde eignen sich für das Gassigehen ohne Leine, besonders solche mit starkem Jagdtrieb
- Auch bei freilaufenden Hunden besteht die Pflicht, die Hinterlassenschaften einzusammeln
Für Tieraufseher ist daher eine private Haftpflichtversicherung wichtig, die Schäden abdeckt, die durch betreute Tiere verursacht werden. Bei gewerblicher Hundebetreuung ist eine spezielle Versicherung ratsam. Wer als Gefälligkeit gelegentlich auf den Hund von Freunden oder Nachbarn aufpasst, sollte klären, ob die Hundehaftpflichtversicherung des Halters auch für fremde Aufsichtspersonen gilt. Dies ist bei vielen Versicherungen der Fall, sollte aber im Vorfeld abgeklärt werden.
Wichtig zu wissen: Beachtet der Tieraufseher bestimmte Auflagen wie einen Leinenzwang nicht und kommt es deswegen zum Unfall, übernimmt in der Regel auch die Versicherung keine Kosten.
Gefälligkeit oder Vertrag? Der rechtliche Unterschied
Die rechtliche Bewertung, ob ein Hundesitter bei Schäden haftet, hängt maßgeblich davon ab, ob ein Verwahrungsvertrag besteht oder eine bloße Gefälligkeit vorliegt. Diese Unterscheidung entscheidet darüber, wer im Schadensfall zur Kasse gebeten wird, wenn ein Hund fremdes Eigentum beschädigt oder jemanden verletzt.
Wann liegt ein Verwahrungsvertrag vor?
Ein Verwahrungsvertrag nach § 688 BGB entsteht, wenn jemand die Aufbewahrung einer Sache – in diesem Fall die Betreuung eines Hundes – übernimmt. Dabei ist nicht entscheidend, ob der Vertrag schriftlich fixiert wurde. Auch mündliche Vereinbarungen oder stillschweigendes Handeln können einen rechtsgültigen Vertrag begründen.
Besonders wichtig: Ein Verwahrungsvertrag kann auch konkludent, also durch schlüssiges Verhalten zustande kommen. Dies geschieht etwa, wenn der Hundehalter seinen Vierbeiner für den mehrwöchigen Urlaub dem Nachbarn übergibt. Rechtlich betrachtet handelt es sich dann um einen Verwahrungsvertrag im Sinne des § 688 BGB oder § 690 BGB.
Professionelle Hundesitter, Hundepensionen oder Tiersitter, die eine Gegenleistung für ihre Tätigkeit erhalten, übernehmen die Aufsicht über das Tier durch einen Vertrag. Folglich haften sie neben dem Tierhalter für Schäden, die der Hund während der Betreuungszeit verursacht.
Mündliche Vereinbarungen und Gegenleistungen
Der Rechtsbindungswille und die vereinbarte Gegenleistung sind entscheidende Faktoren bei der rechtlichen Einordnung. Ein Verwahrungsvertrag kann entgeltlich oder unentgeltlich sein, was im Zweifel durch Auslegung zu ermitteln ist. Die Verwahrung ist dann entgeltlich, wenn das Entgelt als Gegenleistung und nicht nur als Erstattung von Aufwendungen erbracht wird.
Die Gegenleistung muss dabei nicht zwingend finanzieller Natur sein. Auch andere Formen der Vergütung können einen Verwahrungsvertrag begründen:
- Geldleistung für das Hundesitting
- Regelmäßiger Tausch der Betreuung: Wenn zwei Hundehalter vereinbaren, sich zu festen Zeiten mit der Betreuung beider Hunde abzuwechseln, kann dies bereits als vertraglich vereinbartes Hundesitting gelten
- Andere Gefälligkeiten als Ausgleich für die Betreuung
Bei solchen vertraglichen Vereinbarungen gilt: Der Hundesitter haftet neben dem Halter für Schäden, die der Hund bei Dritten verursacht. Allerdings kann sich der Hundesitter – anders als der Halter – von dieser Haftung befreien, wenn er beweisen kann, dass ihn keine Schuld an dem Vorfall trifft.
Gefälligkeit: Was passiert bei gelegentlicher Hilfe?
Von einer Gefälligkeit ohne Rechtsbindungswillen spricht man, wenn jemand nur gelegentlich oder einmalig aus Nettigkeit und kostenlos auf einen Hund aufpasst. Beispiele hierfür sind:
- Die Freundin passt für einige Stunden auf den Hund auf
- Der Nachbar führt den Hund einmal aus
- Ein Familienmitglied beaufsichtigt den Hund kurzzeitig während eines Einkaufs
Bei solchen Gefälligkeitsverhältnissen haftet der Hundesitter grundsätzlich nicht für Schäden, die der Hund verursacht. Der Tierhalter bleibt hingegen weiterhin in der Haftung gemäß § 833 BGB. Passiert in dieser Zeit etwas, übernimmt die Haftpflichtversicherung des Halters die Kosten für entstandene Schäden – vorausgesetzt, das Hüten durch fremde Personen ist im Versicherungsvertrag eingeschlossen.
Allerdings ist die Abgrenzung zwischen Vertragsbeziehung und Gefälligkeit nicht immer eindeutig. Je regelmäßiger und eigenständiger ein fremdes Tier beaufsichtigt wird, desto eher kann von einer vertraglich übernommenen Aufsicht ausgegangen werden.
Für Hundehalter ist daher eine Hundehaftpflichtversicherung unerlässlich, die auch Schäden abdeckt, wenn der Hund von anderen Personen beaufsichtigt wird. Vor dem Abschluss sollte genau geprüft werden, ob das gelegentliche Hüten durch Fremde im Versicherungsvertrag eingeschlossen ist. Die Versicherungssumme sollte zudem ausreichend hoch sein, da ein Hund erhebliche Schäden verursachen kann – etwa wenn er einen Verkehrsunfall auslöst.
Bei professionellen Hundesittern ist darauf zu achten, dass diese in der Regel eine gewerbliche Haftpflichtversicherung haben sollten. Für Privatpersonen, die gelegentlich auf Hunde aufpassen, kann eine private Haftpflichtversicherung sinnvoll sein, die auch Schäden durch fremde Tiere abdeckt.
Hundehaftpflichtversicherung: Schutz für Halter und Sitter
Eine Hundehaftpflichtversicherung bietet unverzichtbaren finanziellen Schutz für Hundehalter, da die Gefährdungshaftung zu erheblichen Kosten führen kann. Während die private Haftpflichtversicherung keine Schäden abdeckt, die ein Hund verursacht, springt hier die spezielle Hundehaftpflicht ein. Angesichts der potenziell hohen Schadenersatzforderungen sollten Hundebesitzer und Hundesitter gleichermaßen die Absicherungsmöglichkeiten kennen.
Was deckt die Hundehaftpflicht ab?
Die Hundehaftpflichtversicherung übernimmt die Kosten für Schäden, die der versicherte Vierbeiner bei Dritten verursacht. Hierzu zählen primär drei Schadensarten:
- Personenschäden: Wenn der Hund jemanden verletzt, werden Behandlungskosten, Verdienstausfall und gegebenenfalls Schmerzensgeld übernommen
- Sachschäden: Beschädigungen an fremdem Eigentum, wenn beispielsweise ein Hund fremdes Auto beschädigt
- Vermögensschäden: Finanzielle Einbußen, die aus Personen- oder Sachschäden resultieren
Darüber hinaus decken viele Versicherungen Flurschäden ab – etwa wenn der Hund auf landwirtschaftlich genutzten Flächen buddelt und dadurch Schäden verursacht. Bei manchen Tarifen sind zusätzlich Mietsachschäden eingeschlossen, wodurch Schäden an gemieteten Gegenständen oder Wohnungen abgesichert sind.
Wichtig zu wissen: Die Versicherung zahlt nicht für Eigenschäden, die der Hund beim eigenen Halter oder bei Mitversicherten verursacht. Kommt es allerdings zu Schäden an gemieteten Objekten wie einer Einbauküche des Vermieters, handelt es sich um einen versicherten Mietsachschaden.
Ist fremden Hund betreuen mitversichert?
Bei der Betreuung fremder Hunde stellt sich die entscheidende Frage: Greift die Versicherung, wenn der Hund während der Beaufsichtigung durch einen Dritten Schaden anrichtet? Die Antwort hängt vom jeweiligen Versicherungsvertrag ab.
Grundsätzlich müssen sich Hundehalter keine Sorgen machen, wenn Partner oder Kinder mit dem Hund Gassi gehen – in diesem Fall sind Schäden bei Dritten weiterhin versichert. Bei nichtgewerblichen Fremdhütern verhält es sich ähnlich: Viele Hundehaftpflichtversicherungen umfassen den sogenannten „Fremdhüter-Schutz“, wodurch Freunde, Nachbarn oder andere Personen mitversichert sind, die gelegentlich und ohne Bezahlung auf den Hund aufpassen.
Jedoch unterscheiden sich die Versicherungstarife erheblich. Wer seinen Hund regelmäßig in fremde Obhut gibt, sollte daher beim Vertragsabschluss besonders auf diesen Leistungspunkt achten. Bei gewerblicher Hundebetreuung, etwa durch einen professionellen Hundesitter oder in einer Hundepension, greift der Versicherungsschutz hingegen meist nicht.
Pflichtversicherung in bestimmten Bundesländern
Inzwischen ist die Hundehaftpflichtversicherung in sechs Bundesländern für alle Hundehalter verpflichtend:
- Berlin (Mindestdeckungssumme: 1 Million Euro für Personen- und Sachschäden)
- Hamburg (Mindestdeckungssumme: 1 Million Euro)
- Niedersachsen (Mindestdeckungssumme: 500.000 Euro für Personenschäden und 250.000 Euro für Sachschäden)
- Sachsen-Anhalt (Mindestdeckungssumme: 1 Million Euro für Personen- und Sachschäden sowie 50.000 Euro für Vermögensschäden)
- Schleswig-Holstein (Mindestdeckungssumme: 500.000 Euro für Personenschäden und 250.000 Euro für Sachschäden)
- Thüringen (Mindestdeckungssumme: 500.000 Euro für Personenschäden und 250.000 Euro für Sachschäden)
In neun weiteren Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen) besteht eine Pflicht zur Hundehaftpflichtversicherung nur für als gefährlich eingestufte Hunde – sogenannte Listenhunde. Einzig in Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine Versicherungspflicht, wobei der Abschluss dennoch empfohlen wird.
Auslandsschutz: Was ist zu beachten?
Für Hundehalter, die mit ihrem Vierbeiner ins Ausland wie z.B. nach Ibiza reisen, ist der internationale Versicherungsschutz ein wichtiger Aspekt. Die meisten Versicherungstarife bieten innerhalb Europas einen zeitlich unbegrenzten Haftpflichtschutz. Bei Reisen außerhalb Europas gilt der Schutz hingegen meist nur für einen begrenzten Zeitraum – häufig für bis zu zwölf Monate.
Voraussetzung für den Auslandsschutz ist üblicherweise, dass sich der Hauptwohnsitz des Hundehalters in Deutschland befindet. Besonders wichtig bei Auslandsreisen: Mietsachschäden in Ferienwohnungen gehören zu den häufigsten Schadenmeldungen.
Folgende Leistungsbausteine sollten bei Auslandsreisen in der Hundehaftpflicht enthalten sein:
- Kein Leinenzwang (außer an Orten mit gesetzlicher Leinenpflicht)
- Forderungsausfalldeckung, falls der Halter eines fremden Hundes nicht versichert oder zahlungsfähig ist
- Schutz bei ungewolltem Deckakt, wenn der eigene Rüde eine fremde Hündin deckt
Zu beachten ist außerdem, dass in manchen Nicht-EU-Ländern eine Hundehaftpflichtversicherung Voraussetzung für die Einreise mit Hund sein kann.
Typische Schadensfälle beim Gassigehen
Beim Gassigang mit Hunden lauern zahlreiche Gefahrensituationen, die schnell zu erheblichen Schäden führen können. Ob ein Biss, ein umgeworfenes Fahrrad oder ein verursachter Verkehrsunfall – die Konsequenzen können sowohl für Hundehalter als auch für Tieraufseher weitreichend sein.
Hund verletzt Passanten
Die häufigsten Personenschäden durch Hunde sind Bissverletzungen, die zu Infektionen, Narben oder dauerhaften Schäden führen können. Gefährlich werden jedoch nicht nur Bisse: Stürzt jemand durch einen anspringenden Hund, kann dies Knochenbrüche und andere schwere Verletzungen verursachen. In manchen Fällen leiden Betroffene anschließend unter psychischen Belastungen wie Angststörungen.
Ein Urteil des OLG Hamm (Az.: 9 U 91/14) zeigt: Selbst wenn jemand einen Hund nur aus Gefälligkeit ausführt, besteht die Verpflichtung, das Tier so zu kontrollieren, dass es keine Passanten gefährdet. In diesem Fall sprang ein Hund einen Passanten an und verletzte ihn im Gesicht, wodurch eine Narbe zurückblieb. Das Gericht verurteilte die Hundebetreuerin zum Schadensersatz.
Laut einem Urteil von 2021 haften Hundehalter übrigens auch, wenn sich die Betreuungsperson beim Gassigehen verletzt – beispielsweise wenn der Hund plötzlich an der Leine zerrt und die Person dadurch stürzt.
Hund beschädigt fremdes Eigentum
Neben Personenschäden können Hunde erhebliche Sachschäden verursachen. Typische Fälle sind:
- Zerkratzte oder beschädigte Fahrzeuge
- Zerstörte Kleidungsstücke oder Wertgegenstände
- Beschädigungen an Gartenmöbeln oder Zäunen
Kommt es während des Gassigangs zu einem Sachschaden, kann der geschädigte Eigentümer vom Hundehalter den Wiederbeschaffungs- oder Reparaturwert einfordern. Hierbei gilt nach § 833 BGB: Der Hundehalter haftet grundsätzlich für alle Schäden, die sein Tier verursacht – unabhängig davon, ob ihn persönlich ein Verschulden trifft.
Selbst wenn der Hund während eines Spaziergangs mit dem Nachbarn Schaden anrichtet, bleibt der Tierhalter in der Haftung. Die Hundehaftpflichtversicherung übernimmt in solchen Fällen die Kosten, vorausgesetzt, das Ausführen durch Dritte ist im Versicherungsvertrag eingeschlossen.
Hund reißt sich los – Verkehrsunfall
Besonders folgenreiche Schäden entstehen, wenn Hunde Verkehrsunfälle verursachen. „Beim Gassigehen kann es schnell zu einem Verkehrsunfall kommen, etwa weil der Hund sich plötzlich losreißt und auf die Straße rennt“, erklärt Benny Barthelmann, Haftpflichtexperte bei der R+V Versicherung.
Ein eindrucksvolles Beispiel liefert ein Fall vor dem OLG Frankfurt: Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, als er mit dem Fahrrad stürzte, nachdem ein Hund sich losgerissen hatte und auf den Rad- und Fußweg gerannt war. Das Gericht sprach dem Verletzten ein Schmerzensgeld von 7.000 Euro zu, da er nun nicht mehr Motorrad oder sportlich Fahrrad fahren kann.
Ebenfalls teuer kann es werden, wenn ein Autofahrer wegen eines plötzlich auf die Straße laufenden Hundes eine Vollbremsung macht und dadurch ein Auffahrunfall entsteht. In einem solchen Fall haftete der Hundehalter zu zwei Dritteln für den Schaden des auffahrenden Fahrzeugs.
Für alle genannten Schadensfälle bietet eine Hundehaftpflichtversicherung unerlässlichen Schutz. Hundehalter sollten daher stets prüfen, ob ihre Versicherung auch Schäden abdeckt, die entstehen, wenn der Hund von anderen Personen beaufsichtigt wird. Die Versicherungssumme sollte zudem ausreichend hoch sein, da insbesondere Verkehrsunfälle erhebliche finanzielle Folgen haben können.
Kinder als Gassigeher: Was ist erlaubt?
Eltern fragen sich häufig, ab welchem Alter Kinder selbständig mit dem Hund Gassi gehen dürfen. Diese Frage hat nicht nur praktische, sondern auch rechtliche Dimensionen – besonders wenn der Hund beschädigt fremdes Eigentum oder jemanden verletzt.
Mindestalter laut Rechtsprechung
In Deutschland existiert keine bundesweit einheitliche Altersregelung, die klar vorgibt, ab wann Kinder allein mit einem Hund spazieren gehen dürfen. Rechtlich betrachtet müssen Personen, die einen Hund führen, „körperlich und geistig die Gewähr dafür bieten, jederzeit den Hund so beaufsichtigen zu können, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden“.
Bei Kindern unter 14 Jahren gehen Behörden davon aus, dass sie generell als ungeeignet zum Führen großer Hunde anzusehen sind. Die Polizei kann in solchen Fällen sogar eine Verwarnung aussprechen. Entscheidend ist hierbei nicht ein festes Alter, sondern vielmehr die individuelle Entwicklung und Reife des Kindes.
Unterschiede je nach Hund und Bundesland
Neben dem Alter des Kindes spielt auch die Größe und Rasse des Hundes eine entscheidende Rolle. Ein kleiner Hund stellt für ein Kind geringere Anforderungen dar als ein großer oder kräftiger Hund. Während ein erfahrenes 12-jähriges Kind möglicherweise einen kleinen, gut erzogenen Hund führen kann, wäre dasselbe Kind mit einem Schäferhund eventuell überfordert.
Zusätzlich existieren in einigen Bundesländern Sonderregelungen für als gefährlich eingestufte „Listenhunde“. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise dürfen solche Hunde nur von Personen ab 18 Jahren geführt werden.
Empfehlung: Versicherung vorher fragen
Besonders wichtig: Viele Hundehaftpflichtversicherungen definieren, dass der Hund nur von einer aufsichtsfähigen Person geführt werden darf. Kinder unter 14 Jahren gelten rechtlich häufig nicht als aufsichtsfähig. Folglich kann die Versicherung im Schadensfall die Zahlung verweigern.
Hundehalter sollten daher unbedingt vor dem Versicherungsabschluss klären, ob die Hundehaftpflicht auch greift, wenn ein Kind den Hund ausführt. Schließlich haften Eltern gemäß § 832 BGB für Schäden, die durch ihre Kinder verursacht werden, wenn sie ihrer Aufsichtspflicht nicht ausreichend nachgekommen sind.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die rechtliche Situation beim Leihen eines Hundes komplex ist. Die Gefährdungshaftung gilt für Hundehalter unabhängig davon, ob sie persönlich beim Schadensfall anwesend waren oder nicht. Allerdings haften Tieraufseher nur bei nachweisbarem Verschulden, was einen entscheidenden Unterschied darstellt. Daher sollten sowohl Hundehalter als auch gelegentliche Gassigeher die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.
Besonders wichtig ist zweifelsohne der Abschluss einer umfassenden Hundehaftpflichtversicherung. Diese schützt nicht nur vor finanziellen Risiken durch Personen- oder Sachschäden, sondern bietet auch Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Tatsächlich kann ein ungesicherter Schadensfall schnell existenzbedrohende Ausmaße annehmen, etwa wenn ein Hund einen Verkehrsunfall verursacht oder jemanden schwer verletzt.
Hundehalter sollten unbedingt prüfen, ob ihre Versicherung auch greift, wenn der Hund von anderen Personen beaufsichtigt wird. Entsprechend sollten Gassigeher vor dem Ausführen eines fremden Hundes klären, ob sie durch die Versicherung des Halters abgedeckt sind oder ob ihre private Haftpflichtversicherung einspringen würde.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Frage, ob das Ausführen eines Hundes als Gefälligkeit oder als vertragliche Verwahrung gilt. Diese Unterscheidung kann weitreichende rechtliche Konsequenzen haben. Je regelmäßiger und eigenständiger ein fremdes Tier beaufsichtigt wird, desto eher liegt ein Verwahrungsvertrag vor.
Eltern sollten darüber hinaus bedenken, dass Kinder unter 14 Jahren generell als ungeeignet zum Führen großer Hunde angesehen werden. Hier droht nicht nur ein Haftungsrisiko, sondern auch eine mögliche Leistungsverweigerung der Versicherung.
Angesichts der strengen Gefährdungshaftung und der potenziell hohen Schadensersatzansprüche bleibt die Hundehaftpflichtversicherung also kein optionales Extra, sondern eine Notwendigkeit für jeden verantwortungsvollen Hundehalter. Sie bietet Schutz vor unkalkulierbaren finanziellen Risiken und sorgt dafür, dass im Schadensfall sowohl Hundehalter als auch Geschädigte abgesichert sind.
FAQs
Q1. Wer haftet, wenn ein fremder Hund während des Gassigehens einen Schaden verursacht? Grundsätzlich haftet der Hundehalter aufgrund der Gefährdungshaftung, auch wenn der Hund von einer anderen Person ausgeführt wird. Der Gassigeher kann jedoch zusätzlich haftbar gemacht werden, wenn ihm ein Verschulden nachgewiesen werden kann.
Q2. Ist eine Hundehaftpflichtversicherung in Deutschland verpflichtend? In sechs Bundesländern (Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen) ist eine Hundehaftpflichtversicherung für alle Hundehalter gesetzlich vorgeschrieben. In anderen Bundesländern besteht die Pflicht nur für bestimmte als gefährlich eingestufte Hunderassen.
Q3. Was ist der Unterschied zwischen einer Gefälligkeit und einem Verwahrungsvertrag beim Hundesitting? Bei einer Gefälligkeit passt jemand gelegentlich und kostenlos auf den Hund auf, ohne rechtliche Verpflichtungen. Ein Verwahrungsvertrag entsteht, wenn die Betreuung regelmäßig oder gegen eine Gegenleistung erfolgt, was zu rechtlichen Verpflichtungen und möglicher Haftung führt.
Q4. Ab welchem Alter dürfen Kinder alleine mit einem Hund Gassi gehen? Es gibt keine einheitliche Altersregelung. Generell gelten Kinder unter 14 Jahren als ungeeignet zum Führen großer Hunde. Entscheidend sind die individuelle Reife des Kindes, die Größe und das Temperament des Hundes sowie mögliche lokale Vorschriften.
Q5. Greift die Hundehaftpflichtversicherung auch im Ausland? Die meisten Hundehaftpflichtversicherungen bieten innerhalb Europas einen zeitlich unbegrenzten Schutz. Außerhalb Europas ist der Schutz oft auf einen bestimmten Zeitraum (häufig bis zu 12 Monate) begrenzt. Es ist wichtig, die genauen Bedingungen des jeweiligen Versicherungsvertrags zu prüfen.