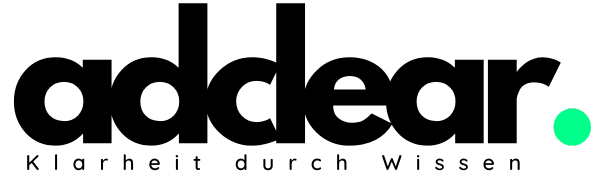Hat man die Chance, durch Glücksspiel entstandene Verluste erstattet zu bekommen, wenn man in einem illegalen Online Casino gespielt hat? Geht es nach dem Obersten Gerichtshof, dann ja. Aber wer ist für die Rückzahlung zuständig? Aktuell gibt es einige brisante Fälle, die die Glücksspielbranche nachhaltig verändern könnten.
Gesetz Bill No. 55 schützt Online Casinos vor ausländischen Klagen
Online Casinos mit deutscher Lizenz sind sicher. Sie müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllen, damit es dann von Seiten der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder – GGL – eine Lizenz gibt. Entscheidet man sich dafür, ein Konto in einem Online Casino ohne deutsche Lizenz zu eröffnen, kann es mitunter problematisch werden. So etwa, wenn das Online Casino die Auszahlung verweigert. Daher ist es besonders wichtig, über CasinoBeats DE seriöse Anbieter zu finden. Nur dann, wenn man die Sicherheit hat, der Anbieter ist seriös, sollte man seine Dienste in Anspruch nehmen.
Blickt man über die deutsche Landesgrenze in Richtung Süden, so könnte ein Urteil des österreichischen Obersten Gerichtshofs – OGH – für nachhaltige Veränderungen sorgen. Eine Spielerin aus Österreich hat bei einem illegalen Online Casino 27.000 Euro verloren – und möchte diese nun zurückhaben. Unzweifelhaft steht fest, dass das Online Casino illegal betrieben wurde. Jedoch sind Glücksspielunternehmen, die ihren Sitz auf Malta haben, vor ausländischen Klagen geschützt – das aufgrund des Gesetzes Bill No. 55. Das Schutzgesetz, das vor rund zwei Jahren in Kraft getreten ist, steht zwar im Kreuzfeuer von der Kritik und wird von Seiten der EU Kommission seit geraumer Zeit untersucht, noch sei es aber gültig. Das Gesetz besagt, dass maltesische Online Casinos nicht in der Pflicht sind, Verluste an Spieler erstatten zu müssen, wenn diese aus illegalen Geschäften hervorgegangen sind.
Neuer Plan: Nicht das Glücksspielunternehmen, sondern die Bank soll das Geld zurückbezahlen
Schon im Dezember 2024 hat der OGH unter 3 Nc 72/24d entschieden, dass das Urteil zur Rückzahlung von Verlusten der Spieler auch in Österreich durchgesetzt werden darf. Aber man darf nicht erwarten, dass der Betreiber des Online Casinos die Rechtsauffassung akzeptiert und sich dieser in weiterer Folge beugt. Jedoch kann sich auf Grundlage dieser Entscheidung ein neuer Weg eröffnen: Denn die Spielerin will jetzt nicht das Geld vom Online Casino, sondern fordert die Bank auf, die das Geld des Glücksspielunternehmens aufbewahrt, den Verlust rückzuerstatten. Von Seiten der Bank gab es bereits die Ablehnung; eine freiwillige Auszahlung werde, so die Verantwortlichen, nicht erfolgen.
Nun plant die Spielerin, die Bank zu verklagen. Dabei handelt es sich um eine Drittschuldnerklage. Das heißt, mittelbar in illegale Geschäfte verstrickte Unternehmen können haftbar gemacht werden. Eine Grundidee, die auch in Deutschland verfolgt wird.
Wie geht es weiter, wenn die Drittschuldnerklage nicht zum Erfolg führt?
Wenn die Klage gegen die Bank scheitert, so hat die österreichische Spielerin bereits einen Plan B: In weiterer Folge möchte man die Bankeinlagen bei der Europäischen Zentralbank – EZB – einfordern. Zum aktuellen Zeitpunkt ist aber unklar, ob es sich um einen effektiven Handel handelt, der zur Vollstreckung geeignet ist.
Zudem darf man nicht außer Acht lassen, dass der Prozess Jahre in Anspruch nehmen kann. Experten gehen nämlich davon aus, diese Entscheidung könnte zum Präzedenzfall werden – das muss natürlich entsprechend vorbereitet werden.
Aufgrund der Tatsache, dass derartige Fälle in Österreich erst nach 30 Jahren verjähren, besteht kein Zeitdruck. Man ist also nicht in der Pflicht, ein vorschnelles Urteil zu treffen.
Wie wird der EuGH entscheiden?
Eine wegweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs – EuGH – sollte bereits am 9. April 2025 erfolgen. Dabei geht es um die Frage, ob es einem ausländischen Online Casino wirklich erlaubt werden darf, trotz fehlender deutscher Lizenz, das Angebot in Deutschland anbieten zu dürfen, weil man sich auf die Dienstleistungsfreiheit der EU beruft (Artikel 56 des Vertrags über die Arbeitsweise). In erster Linie mag das zwar Deutschland betreffen, doch die Entscheidung des EuGH könnte einen Einfluss auf die gesamte EU haben. Denn es geht um die Frage, ob das nationale Glücksspielgesetz in der EU relevanter als die Rechtsrahmen sind, die durch die sogenannte Dienstleistungsfreiheit vorgegeben werden.
Aufgrund der Tatsache, dass die Schlussanträge aber erst mit 10. Juli 2025 erwartet werden, lässt die Entscheidung noch auf sich warten.